# Open Data Grundlagen
# ABC der Offenheit – Grundlegende Einführung
*Gemeinsam mit Wikimedia hat die Open Knowledge Foundation Deutschland eine [Broschüre ](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABC_der_Offenheit_-_Brosch%C3%BCre_(2019).pdf)aufgelegt, die eine Einführung in Themen wie Open Data, Open Education und Open Government gibt.*
Die Broschüre bietet einen umfassenden aber dennoch kurzweiligen Einstieg zum Thema Offenheit und ist in drei Teile gegliedert: Nach einer allgemeinen Einleitung ins Thema (A) werden einzelne Teilbereiche vorgestellt, in denen Offenheit praktiziert wird (B). Die wichtigsten Begriffe zum Thema können im [Glossar ](https://opendata.okfn.de/books/open-data-grundlagen/page/glossar "Glossar")(C) nachgeschlagen werden.
[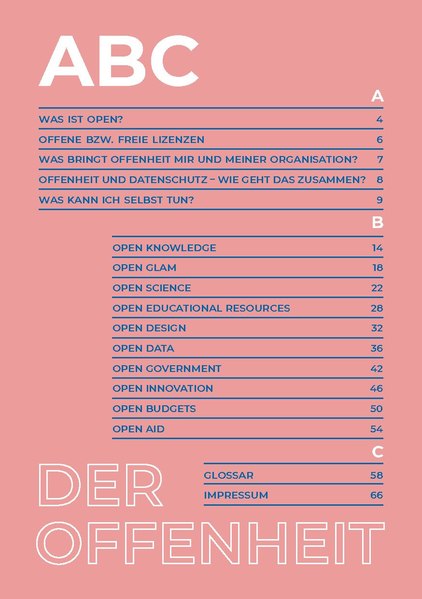](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABC_der_Offenheit_-_Brosch%C3%BCre_(2019).pdf)
# Leitfäden und einführende Handreichungen
*Hier finden Sie eine alphabetisch sortierte Liste mit einführenden Handreichungen von verschiedenen Akteur:innen. Wenn Sie nach einem bestimmten Thema suchen, nutzen Sie einfach die **Suchfunktion,** oder wählen Sie das Thema aus der **Navigation auf der linken Seite** aus.*
[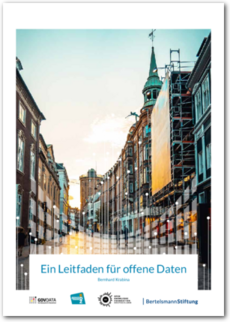](https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/ein-leitfaden-fuer-offene-daten)
[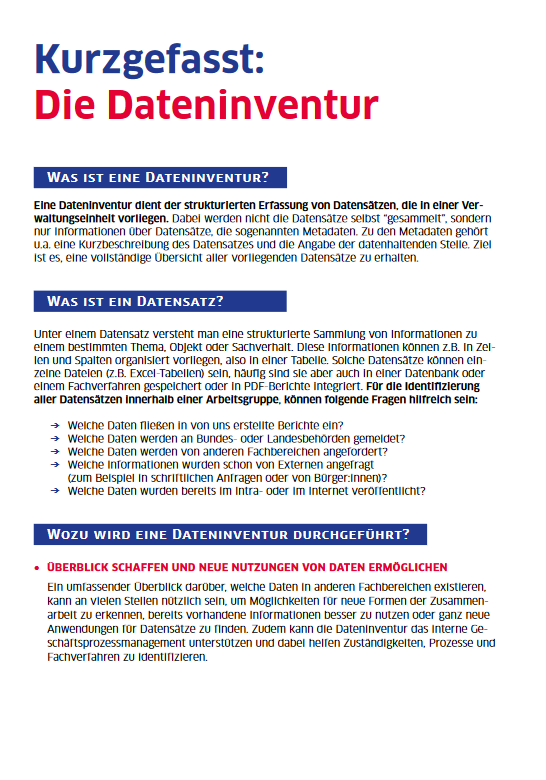](https://odis-berlin.de/ressourcen/dateninventur/)
### Dateninventur
Um Daten als Open Data bereitstellen zu können, muss erst einmal Klarheit darüber herrschen, **welche Daten überhaupt vorhanden sind**. Die Open Data Informationsstelle Berlin ist diesem Thema nachgegangen und hat ein [Handout zum Thema Dateninventur](https://odis-berlin.de/ressourcen/dateninventur/) erstellt, der im Vorgehen auch über die Berliner Landesgrenzen hinaus anwendbar ist.
[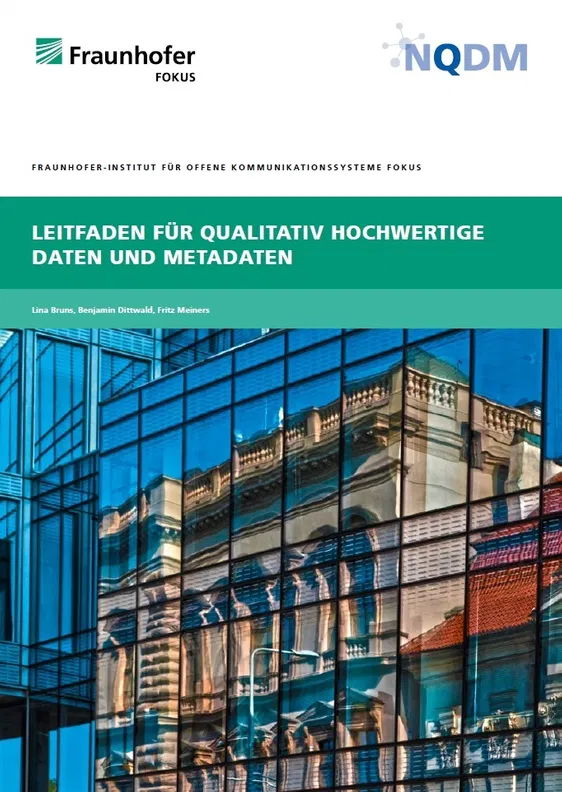](https://www.nqdm-projekt.de/de/downloads/leitfaden)
[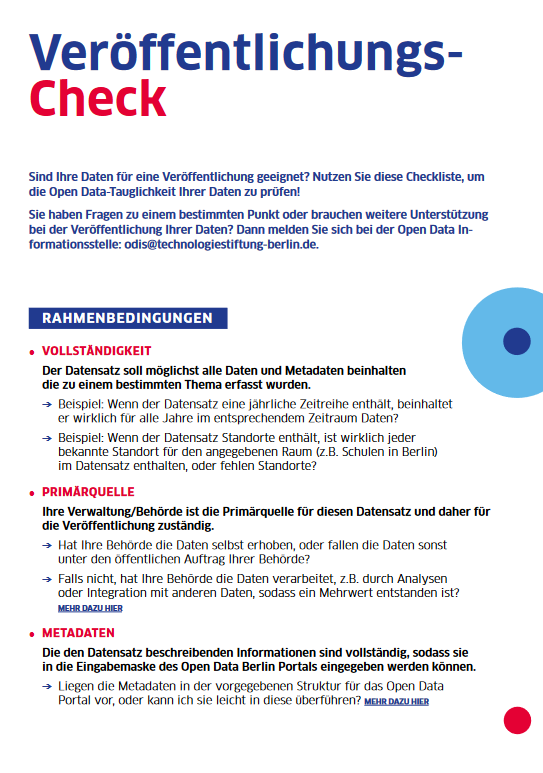](https://odis-berlin.de/assets/file-download/open_data_checkliste.pdf)
[](https://open.nrw/datensouveraenitaet-praxisleitfaden)
[](https://open.bydata.de/static/openbydata_HVD_Handreichung.pdf)
### Hochwertige Datensätze (High Value Datasets)
Laut der [Durchsetzungsverordnung zu Hochwertigen Datensätzen 2023/138](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R0138https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R0138) der Europäischen Kommission müssen Behörden ab Juni 2024 bestimmte Daten anhand vorgegebener Kriterien veröffentlichen. In Deutschland wird bildet das [Datennutzungsgesetz](https://www.gesetze-im-internet.de/dng/DNG.pdf) die rechtliche Grundlage;
in der EU-Durchsetzungsverordnung sind die Datenkategorien und Standards für die Veröffentlichung festgelegt. Eine **abschließende rechtliche Bewertung des zuständigen Bundesministeriums für Wirtschaft gibt es aktuell noch nicht**. In der vorliegenden Handreichung von [open bydata, byte – Bayerische Agentur für Digitales GmbH](https://open.bydata.de) wird aber davon ausgegangen, dass die Regelung nicht dazu verpflichtet, neue Daten zu erheben, sondern die Vorgaben lediglich für die bereits veröffentlichen Datensätze bindend sind. Die Handreichung ist als Vorbereitung für bayerischen Datenstellen verfasst, bietet aber auch Behörden aus anderen Bundesländern wertvolle Hinweise, wie man sich bereits jetzt auf die Richtlinie vorbereiten kann.
[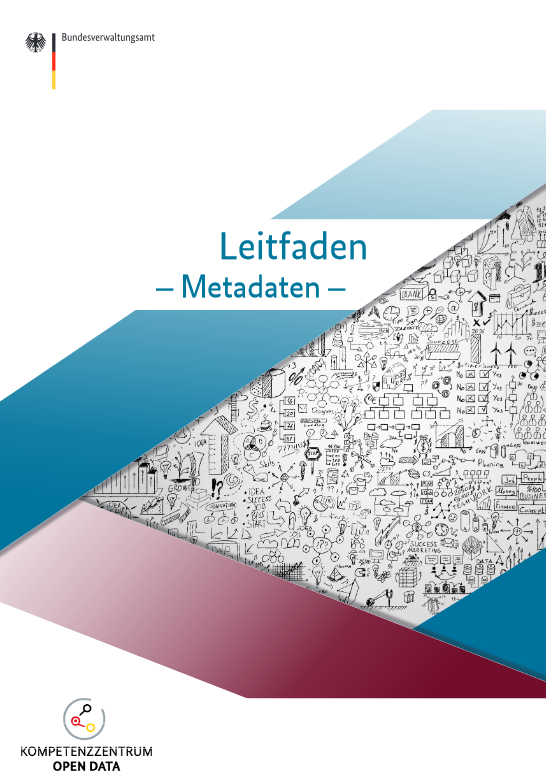](https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Behoerden/Beratung/Methoden/open_data_leitfaden_metadaten.pdf)
### Metadaten
Für die Auffindbarkeit von Daten sind Metadaten unabdingbar. Auch wenn Sie z.B. einen Datensatz über das [deutsche Datenportal govdata ](https://www.govdata.de/de/web/guest/datenbereitstellungaufgovdata)bereitstellen wollen, müssen Sie sich an bestimmte Kriterien halten. Der Leitfaden des Kompetenzzentrums Open Data beantwortet **grundlegende Fragen rund um das Thema Metadaten** und geht dabei auch auf das Webformular für die manuelle Eingabe von Daten auf [govdata ](https://www.govdata.de/de/web/guest/datenbereitstellungaufgovdata)im Speziellen ein.
### Musterdatenkatalog
Gemeinsam mit der OKF, der KDVZ und GovData hat die [Bertelsmann Stiftung einen interaktiven Musterdatenkatalog](https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/musterdatenkatalog) entwickelt, der Kommunen einen ersten **Anhaltspunkt** **gibt, welche Daten sie als Open Data veröffentlichen könnten**. Kommunen, die mit der Veröffentlichung offener Daten beginnen wollen, können schnell in Erfahrung bringen, welche Art von Datensätzen von Kommunen als Open Data veröffentlicht werden.[](https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/smart-country/musterdatenkatalog)© Bertelsmann Stiftung
### Open-Data-Koordination
Im vom [Kompetenzzentrum Open Data (CCOD)](https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoerden/Beratung/Beratungszentrum/OpenData/opendata_node.html;jsessionid=BAB6369896058396A68E5A97E33D351A.intranet251 "Kompetenzzentrum Open Data (CCOD)") des Bundesverwaltungsamts entwickelten [Leitfaden ](https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoerden/Beratung/Beratungszentrum/OpenData/ODK_Leitfaden/leitfaden_node.html)wird detailliert beschrieben, wie Open-Data-Projekte in Behörden eingeführt werden können, welche unterschiedlichen Rollen bei Projekten zu beachten sind und wie die Prozesse hin zur Veröffentlichung von Daten aussehen können. Das Leitfaden zielt auf Bundesbehörden ab, ist aber in seinen Details auf andere Behörden übertragbar.
[](https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoerden/Beratung/Beratungszentrum/OpenData/ODK_Leitfaden/leitfaden_node.html)
© CCOD Bundesverwaltungsamt
[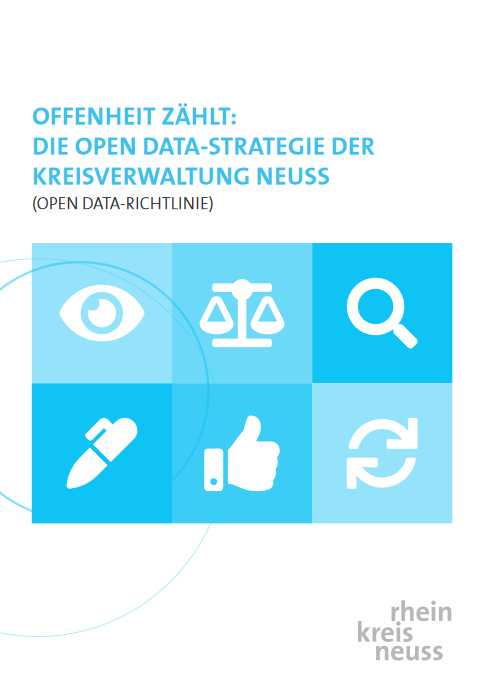](https://rkn.nrw/upload/2019_Open_Data_Richtlinie.pdf)
### Open-Data-Richtlinie
Grundsätzlich können sich Behörden auch eigene Open-Data-Richtlinien auflegen. Das Regelwerk kann Verwaltungsmitarbeitende dabei unterstützen, geeignete Daten im Zuständigskeitsbereich zu identifizieren, aufzubereiten und in einem nächsten Schritt zu veröffentlichen. Das Zustandekommen einer solchen Richtlinie hängt dabei maßgeblich von der Unterstützung der Leitungsebene ab. Die [Erfahrung des Open-Data-Beauftragten Tobias Schellhorn](https://opendata.okfn.de/Themen/open-data-in-der-praxis/Seite/tobias-schellhorn-open-data-beauftragter-des-rhein-kreis-neuss "Tobias Schellhorn, Open-Data-Beauftragter des Rhein-Kreis Neuss") in Neuss zeigt, dass es im Umgang mit Fachbereichen hilfreich sein kann, auf eine existierende Richtlinie und damit auch die Rückendeckung der Führungsebene verweisen zu können. Ähnliche Modelle wie das vorliegende Beispiel in Neuss sind auch in anderen Verwaltungskonstellationen denkbar.